- Start / Sprache
- Stromproduktion mit HHO-Gas
- HHO Systeme in Autos
- Geothermie Allgemein
- Geothermie Rumänien
- Partner und Links
- Sponsoring / Gönner
Hoch Temperatur
In grösserer Tiefe und bei höherer Temperatur hat das
kristalline Grundgebirge ein grosses Potenzial für Stromproduktion und
gleichzeitige Wärmeerzeugung. In der Schweiz ist das DHM Projekt in Basel
das erste, das versucht, diese Energie zu nutzen.
In den nächsten Jahren werden in unserem Land aber sicher weitere
Projekte zur Stromproduktion entstehen.
 Beträgt
die Temperatur der geothermischen Wärmequelle über 100°C, so kann eine
Umwandlung der Wärme in Strom rentabel. Das geothermische Fluid steigt im
Bohrloch unter hohem Druck und hoher Temperatur auf, weshalb es aus einem
Wasser-Dampf-Gemisch besteht. Der Energieinhalt des unter Druck stehenden
Dampfes wird mittels Turbine und Generator in Strom umgewandelt, welcher
dann in ein existierendes Verteilnetz eingespeist wird.
Beträgt
die Temperatur der geothermischen Wärmequelle über 100°C, so kann eine
Umwandlung der Wärme in Strom rentabel. Das geothermische Fluid steigt im
Bohrloch unter hohem Druck und hoher Temperatur auf, weshalb es aus einem
Wasser-Dampf-Gemisch besteht. Der Energieinhalt des unter Druck stehenden
Dampfes wird mittels Turbine und Generator in Strom umgewandelt, welcher
dann in ein existierendes Verteilnetz eingespeist wird.
Am Ausgang der Turbine, also nach der Umwandlung der geothermischen Energie in Strom, ist die Temperatur des Fluids immer noch hoch. Dies erlaubt anschliessend eine direkte Wärmenutzung, beispielsweise zur Gebäudeheizung.
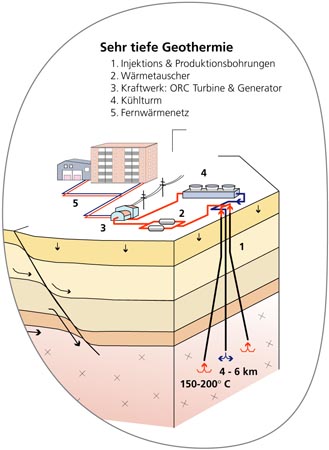 Bis
heute konzentrierte sich die geothermische Nutzung in der Schweiz
ausschliesslich auf Wärme- und Kälteerzeugung. Einen grossen Schritt in
Richtung Stromerzeugung bietet das «Enhanced Geothermal System (EGS) /
Stimulierte Geothermische System (SGS)», also das künstliche Erzeugen
eines tief im Kristallingestein liegenden Wärmetauschers. Mit dieser in
Entwicklung stehenden Technik soll es möglich werden, Bandenergie, also
jederzeit verfügbare Energie, zu erzeugen – ein bei erneuerbaren
Energien selten anzutreffender Vorteil. Das in Bohrungen injizierte Wasser
wird im künstlich geklüfteten Kristallingestein in rund 5 km Tiefe auf
200 °C erhitzt. Zurück an der Oberfläche dient die geförderte Energie
zum Betreiben einer Turbine mit gekoppeltem Generator.
Bis
heute konzentrierte sich die geothermische Nutzung in der Schweiz
ausschliesslich auf Wärme- und Kälteerzeugung. Einen grossen Schritt in
Richtung Stromerzeugung bietet das «Enhanced Geothermal System (EGS) /
Stimulierte Geothermische System (SGS)», also das künstliche Erzeugen
eines tief im Kristallingestein liegenden Wärmetauschers. Mit dieser in
Entwicklung stehenden Technik soll es möglich werden, Bandenergie, also
jederzeit verfügbare Energie, zu erzeugen – ein bei erneuerbaren
Energien selten anzutreffender Vorteil. Das in Bohrungen injizierte Wasser
wird im künstlich geklüfteten Kristallingestein in rund 5 km Tiefe auf
200 °C erhitzt. Zurück an der Oberfläche dient die geförderte Energie
zum Betreiben einer Turbine mit gekoppeltem Generator.
Hydrothermale Anlagen nutzen in anderen Ländern Aquifere in Tiefen von 1’500 – 2’000 Metern und erreichen damit Temperaturen von 100 – 350 °C.
Schema zur Nutzung eines sehr tiefen geothermischen Reservoirs zur Strom- und Wärmeerzeugung.Grafik S. Cattin, CREGE